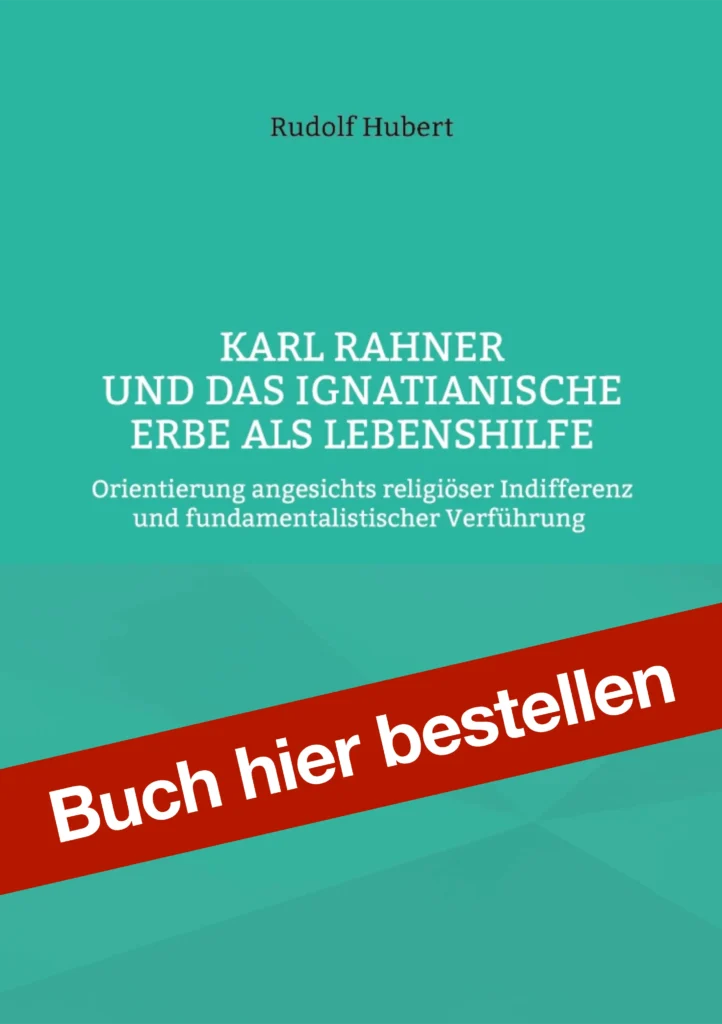Autor: Rudolf Hubert | Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter
Vorwort: Thomas Hoffmann
Dieses Buch bietet eine theologische Reflexion über den Glauben. Dabei geht es vor allem um den ‚Transzendenzbezug‘ des Menschen, also über die – religiös gesprochen – göttliche Realität, die über sämtliches Materielle und somit auch über die menschliche Erfahrung hinausgeht und als unabhängig von der Welt verstanden wird. Diese Realität begründet das menschliche ‚Über-Sich-Hinausgehen‘ und stellt von daher auch die Herausforderung des heutigen Lebens dar, das sich oft genug in einer fast völlig säkularisierten Welt ‚einschließen‘ möchte.
Dem stellt das Buch die religiöse Indifferenz allem Endlichen gegenüber und tritt damit das geistige Erbe von Ignatius von Loyola an, wie es besonders Karl Rahner in heutiger Zeit vermittelt hat.
Eine zentrale Botschaft dabei ist, dass die Erfahrung der Transzendenz zugleich eine Erfahrung der Gnade ist. Gnade wird verstanden als personales Angebot der Selbstmitteilung Gottes.
Gott ist dabei das unbegreifliche Geheimnis der Liebe und Barmherzigkeit, das Menschen zu einer offenen Haltung gegenüber endlichen Dingen und ideologischen Götzenbildern einlädt und es ermöglicht, sich auf diesen – nahegekommenen – Gott einzulassen.
Das Buch verschweigt auch nicht die Herausforderungen in einer Zeit, in der Gott scheinbar vergessen oder als irrelevant empfunden wird und die es schwer machen, den Glauben zu vermitteln. Viele Menschen können scheinbar ohne einen Glauben ein erfülltes Leben führen. Gott ist da vollkommen überflüssig. Die Frage bleibt, ob dieser Lebensentwurf hält und trägt.
Rudolf Hubert wünscht sich eine Kirche, die ihre Rolle auch im Dialog versteht, in dem sie nicht nur lehrt, sondern auch lernt, die Menschen als Subjekte des Glaubens zu respektieren und sensibel zu sein bzw. zu werden für die Vielfalt der Lebenswirklichkeit. Dazu ermuntern ihn auch viele „anonyme Christen“, ein Begriff Karl Rahners, der Menschen beschreibt, die ohne besondere Glaubensbekenntnisse dennoch im Geist Christi leben. Ich selbst kenne solche Menschen, die bei Gesprächen über meinen Glauben eher abwinken und trotzdem meine Werte teilen. Das Wording ist oft unterschiedlich. Ich spreche von ‚Schöpfung‘, andere Menschen nennen das ‚Natur‘.
Die berühmte „Legende vom Großinquisitor“ wird als prophetischer Text interpretiert, der die Spannung zwischen Freiheit und Glück, zwischen individueller Verantwortung und autoritärer Führung beleuchtet. Der Großinquisitor wirft Jesus vor, den Menschen eine Freiheit gegeben zu haben, die sie überfordert und unglücklich macht. Er selbst habe die Menschen von dieser Last befreit, indem er ihnen die Freiheit nahm und sie lenkte. Diese Legende kann heutzutage als Spiegel für gesellschaftliche Verführungen und politische Radikalisierungen gesehen werden. Wer die verheerenden Folgen von Nationalsozialismus, Stalinismus und der Kriege verschweigt oder verharmlost, bereitet den Boden für die Anfälligkeit für totalitäre Ideologien, die mit religiöser Rhetorik verknüpft werden können.
Ignatianische Impulse können angesichts vieler ‚Großinquisitoren‘ heute verlässlich Orientierung bieten angesichts verschiedenster Verführungen und gesellschaftlicher Krisen.
Mich interessiert, nicht ob, sondern wo Anknüpfungspunkte für die Glaubensbotschaft liegen und wie die Kirche ihre Aufgabe erfüllen kann. Das Buch nennt Voraussetzungen, um Glauben und Hoffnung in Liebe lebendig zu halten. Dabei wird der Glaube als lebensnotwendiger Schatz beschrieben, der Sinn und Hoffnung in einer komplexen und oft widersprüchlichen Welt bietet.
Thomas Hoffmann, Norddeutscher Rahner Kreis